Seit den ersten großflächig eingesetzten betrieblichen Softwareanwendungen schritten die Möglichkeiten zur Software(weiter)entwicklung in der Unternehmenswelt bis heute im Eiltempo voran. Software und IT-Technologieunternehmen wie Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, IBM oder SAP haben sich längst zu den klassischen alt-industriellen Wirtschaftsriesen der Vergangenheit dazugesellt, obwohl sie keine rein physischen Produkte, wie Autos, Öl oder Konsumgüter anbieten. Doch wie kam es so weit?
Der Schlüssel zum Erfolg

Der Schlüssel zu ihrem Erfolg lag in der Möglichkeit, mit Programmiersprachen Software und Applikationen zu entwickeln und daraus bis dahin eher unkonventionelle Produkte zu erschaffen. Mit den neu entstandenen Softwareprodukten konnte der Business-Welt die Aussicht auf Effizienzsteigerung durch Automatisierung oder interne und externe Vernetzung hin zu Wertschöpfungsketten in Aussicht gestellt werden. Nicht zu vergessen lockt auch die Aussicht auf einen der wichtigsten aller unternehmerischen Grundsätze: Kostenersparnis. Früher war Kostenersparnis im Sinne der alten Schule die oberste Maxime der Betriebswirtschaftslehre. Später einigte man sich im Zuge der Klimafreundlichkeit auf Ressourceneffizienz im Allgemeinen. Allerdings erwies sich im Wandel der Wirtschaftsjahre die Innovationskraft eines Unternehmens ebenfalls als zunehmend relevant für den Produktabsatz. Aber egal ob die Unternehmensstrategie sich in der Kostenführerschaft oder in Innovationsdifferenzierung auf dem Markt für den Kunden äußerte, all das konnte mit der Implementierung von Software in die hausinternen Prozesse erreicht oder verbessert werden. Sofern die Existenzsicherung eines Unternehmens also auf der Prioritätenliste ganz oben stand, war die Implementierung von Software in das eigene Unternehmen nicht nur eine Notwendigkeit, sondern einfach eine Frage der Zeit.
Der Mangel an IT-Muttersprachlern
Damit jedes Unternehmen mit entsprechenden Softwareprodukten versorgt werden konnte, wurden Software oder Applikationen bis vor einigen Jahren meistens ganz klassisch von InformatikerInnen in einer für Laien eher weniger nachvollziehbaren Programmiersprache entwickelt. Um die Karriereleiter der heiß begehrten Berufsgruppe „ProgrammiererInnen“ zu erklimmen, bedurfte es einer entsprechend zeitaufwendigen Ausbildung, einer intensiven Leidenschaft für Mathematik und im Idealfall einer gewissen Entkopplung von sozialen Verbindungen, welche sich dann in der Erprobung der eigenen Fähigkeiten mit Programmiersprachen bemerkbar machte. Früher wie heute sind ProgrammiererInnen sehr gefragt, denn lange nicht mehr sind nur die Unternehmen auf digitale Produkte angewiesen, sondern auch unsere Regierungen für bürokratische Abläufe, unsere Privatpersonen in der Freizeit, unsere medizinische Versorgung, unser öffentlicher Nahverkehr, unser Militär, unsere Lebensmittelversorgung – Sie merken es: einfach alles.
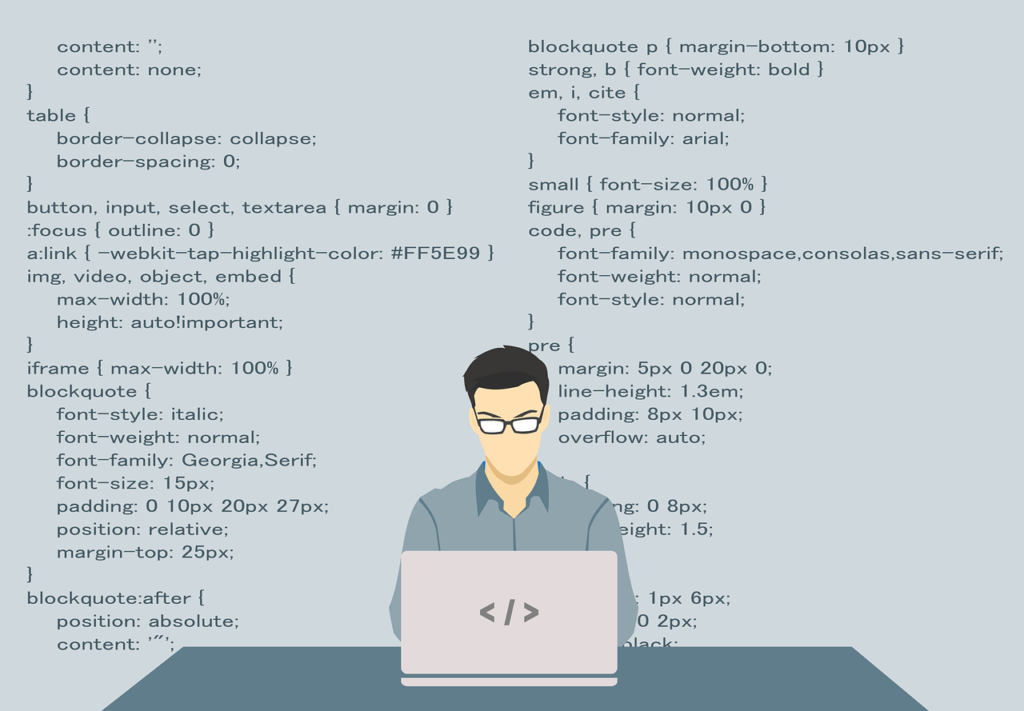
ProgrammiererInnen gehören zu einer der wichtigsten Berufsgruppen unserer modernen Welt. Sie treiben die Lebensgrundlage für unsere Gesellschaft und Wirtschaft voran: Digitalisierung – oder konkreter: Softwaresysteme & Applikationen. Nun wird der ein oder andere selbsternannte disruptive Innovator mit dem Vorschlag vortreten, dass es für den Markt doch vollkommen ausreiche, wenn man nur ein paar mehr ProgrammiererInnen für die Zukunft ausbildet. Ergo pendelt sich die Nachfrage wieder ein. Gegen diese Idee sollen zwei Gegenargumente angeführt werden: Erstens verwette ich mein Erspartes darauf, dass wir niemals genügend Jugendliche für Informatik begeistern könnten, um den Bedarf an ausgebildeten ProgrammiererInnen zu decken. Zweitens werden die Anforderungen an die kommenden InformatikerInnen der Zukunft immer komplexer. Wenn auf einmal für ALLES Software benötigt wird, müssen ProgrammiererInnen plötzlich nicht nur programmieren können, sondern gleichzeitig auch Experten für verschiedene Fachbereiche werden. Mit der Zeit steigt der Bedarf an MitarbeiterInnen mit einer Kombination aus technischem Know-How, fachspezifischen Kenntnissen und vermehrt sozialen Team-Fähigkeiten so stark, dass sich mittlerweile AbsolventInnen der Informatik beinahe ihre Lieblingsfirmen aussuchen können. Was wir hier jetzt einfach als gesellschaftliche Errungenschaft für die Selbstbestimmung junger Menschen feiern könnten, ist allerdings für Unternehmen extrem kritisch. Die Kritikalität lässt sich aus dem steigenden Innovations- und Leistungsdruck der modernen Wirtschaft ableiten. Früher galt es durchaus noch als vertretbar, langwierig geplante Abstimmungstermine zwischen dem rein ökonomischen Fachbereich und der Softwareentwicklungsabteilung zu führen. Individuelle Abweichungen vom Standardangebot zogen meist zeitaufwendige Softwareprojekte als Konsequenz nach sich. Heutzutage wird da eher die schnelle und kostengünstige Individuallösung bevorzugt und auch auf Grund steigenden Innovationsdrucks benötigt. Und weil ProgrammiererInnen nicht auf Bäumen wachsen und FachbereichsmitarbeiterInnen häufig schlichtweg nicht die Zeit haben, sich entsprechende Programmierkenntnisse in kurzer Zeit anzueignen, muss eine andere Lösung her. Das Zauberwort heißt Low-Code/No-Code. Ziel ist die Beschleunigung der Applikationsentwicklung durch den Einsatz von wenig bis keinem Programmiercode. Meist geschieht das auf einer dazu bereitgestellten Plattform eines externen Plattformanbieters, welche auch als Low-Code-Development-Platform (LCDP) bekannt ist [1,2].
Ein möglicher Weg aus dem Fachkräftemangel

Der Ansatz hinter Low-Code zeigt gleichzeitig auch die Lösung des Problems: Wenn zu wenige ProgrammiererInnen bei immer steigendem Bedarf für Softwareentwicklungsprojekte gesucht werden, dann muss eben eine Entwicklungsmöglichkeit für weniger technisch versierte MitarbeiterInnen gefunden werden. Mit LCDPs können in der Cloud gehostete Applikationen in einer Platform-as-a-Service-Lösung (PaaS) als Alternative oder Erweiterung zur herkömmlicher Hard-Code-Softwareentwicklung genutzt werden. Für einen regelmäßigen Obolus an das entsprechende LCDP-Softwareunternehmen bekommt man vorgefertigte Funktionen zur Prozessautomatisierung oder Applikationsentwicklung nach gängigen Softwareentwicklungsansätzen, büßt allerdings auch etwas Unabhängigkeit bei der Softwareentwicklung ein. Absolviert man noch die notwendigen Trainings und Schulungen für die Bedienung des Low-Code-Entwicklungstools, welche in der Regel weniger Zeit beanspruchen sollten als eine umfängliche Ausbildung zu einer/einem Vollblut-InformatikerIn, sind auch FachbereichsmitarbeiterInnen in der Lage Software zu gestalten [2,3]. Als neue AnwärterInnen der Softwareentwicklung dürfen diese unter dem Namen des Citizen Developers (CDs) Applikationen eigenständig nach subjektivem Eigenbedarf entwickeln. Klingt nach einem guten Deal, oder? Doch nicht so schnell.
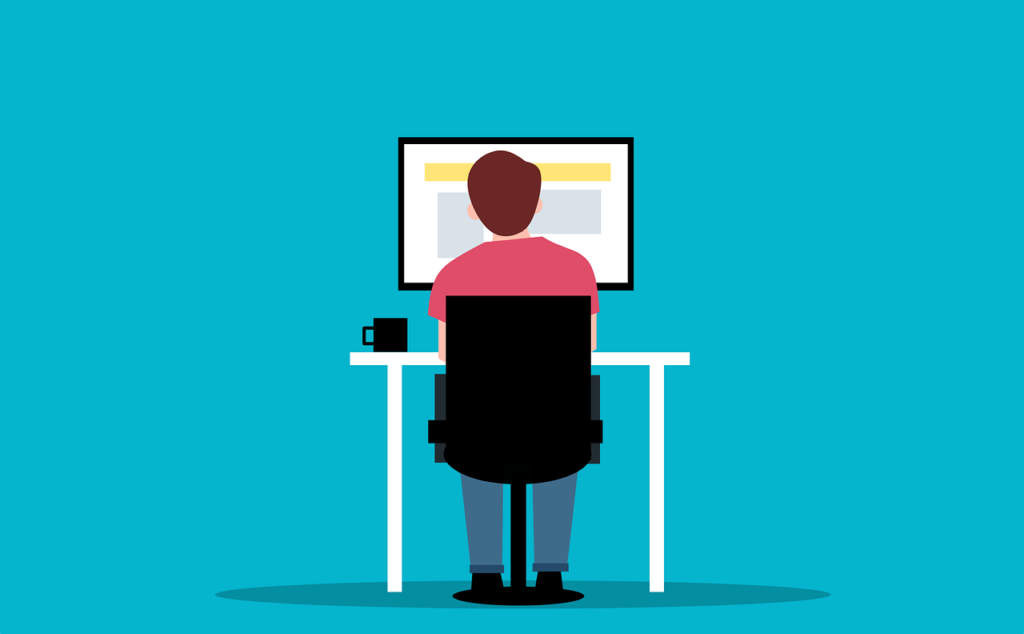
Auf viel Macht folgt viel Verantwortung
Sicherlich sind Sie bereits einmal in Ihrem Leben mit Softwareentwicklung in Berührung gekommen. Vermutlich wird Ihnen dann spätestens bei der Tatsache schwindelig, wenn auf einmal beliebige MitarbeiterInnen Stammdaten & Bewegungsdaten Ihres Unternehmens über unzählige Schnittstellen zu den unterschiedlichsten Zwecken nutzen könnten. Sei es die Erstellung einer Applikation zur internen Gehaltsverwaltung, ein BI-Dashboard für Quartalsberichte auf C-Level, ein Webshop für den Produktverkauf auf Ihrem Onlineportal oder eine einmalig verwendete App zur Auszählung potenziell bereitwilliger KuchenbäckerInnen für den 40ten Geburtstag ihres geschätzten Kollegen? Es kommen definitiv Fragen und Zweifel auf! Wie wähle ich die geeignete Low-Code-Plattform? Wie abhängig werde ich von einem externen Anbieter? Welche Prozesse dürfen überhaupt digitalisiert werden? Gibt es Zugangsbeschränkungen? Welche Daten dürfen von der Entwicklungsplattform verwendet werden? Sind Daten an den Schnittstellen für Unbefugte sichtbar? Dies ist nur eine kleine beliebige Auswahl an möglichen Fragestellungen. Es wird aber offensichtlich, dass es sich nicht nur lohnt, sondern im Zweifel sogar notwendig ist, den Einsatz von LCDPs vorab zu strukturieren und zu regulieren. In den meisten IT-Abteilungen wird die Softwareentwicklung von IT-Governance-Guidelines oder Steuerungsrichtlinien kontrolliert – und das bereits sehr erfolgreich. Doch die Erarbeitung einer IT-Governance in Anlehnung an die Geschäftsstrategie birgt viele Fettnäpfchen und Herausforderungen. Mit welchen Herausforderungen und Komplikationen Unternehmen hier bei der Umsetzung kämpfen und wie bisherige Best-Practices bezüglich LCDPs aussehen könnten, betrachten wir im nächsten Beitrag – also nutzen Sie schonmal die Zeit zum Grübeln, vor welchen Hürden Sie bisher stehen? Wir freuen uns auf den nächsten Blogbeitrag und sind gespannt auf Ihre Erfahrungen mit LCDPs.
Literatur:
[1] Prinz, Niculin, Christopher Rentrop, and Melanie Huber. „Low-Code Development Platforms-A Literature Review.“ AMCIS. 2021.
[2] Prinz, Niculin, et al. „Two Perspectives of Low-Code Development Platform Challenges–An Exploratory Study.“ PACIS 2022, Pacific Asia Conference on Information Systems, July 5-9, 2022, Virtual Conference. Vol. 235. 2022.
[3] A Leader in the 2023 Gartner® Magic Quadrant™ for Enterprise Low-Code Application Platforms
Bitte zitieren als: Bitco³ Niculin Prinz, Tim Klos (2023). Low-Code-Development-Platforms: Aus Not wird ein Trend? – 27.02.2023. Online verfügbar unter https://bitco3.com/?p=13318
Bildquelle: Pixabay (https://pixabay.com)

